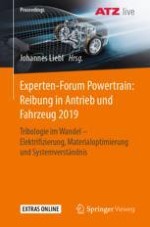2020 | Buch
Über dieses Buch
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Tagungsbands zur ATZlive-Veranstaltung Experten-Forum Powertrain: Reibung in Antrieb und Fahrzeug 2019 liegen u.a. auf immer strengeren CO2-Grenzwerten und der Erfüllung der damit einhergehenden anspruchsvollen Prüfzyklen unter realen Fahrbedingungen. Die Tagung ist eine unverzichtbare Plattform für den Wissens- und Gedankenaustausch von Forschern und Entwicklern aller Unternehmen und Institutionen, die dieses Ziel verfolgen.
Anzeige