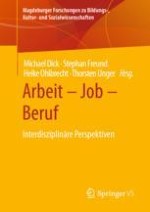2022 | OriginalPaper | Buchkapitel
Kinderarbeit und neoimperiale Lebensweise im Zeitalter der Globalisierung
Miki Mistratis The Dark Side of Chocolate
verfasst von : Claudia Lillge
Erschienen in: Arbeit – Job – Beruf
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by